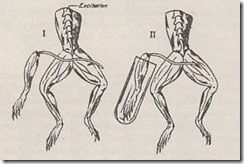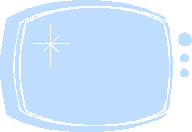Günter Grass hat’s schon wieder getan: Er lässt sich das Dichten einfach nicht verbieten! Diesmal hat er “Duftmarken” gesetzt. Sein Göttinger Verleger, Gerhard Steidl, kam nämlich auf die Idee, ein Parfüm herstellen zu lassen, das nach nichts anderem als nach Büchern und Papier duftet.
Günter Grass hat’s schon wieder getan: Er lässt sich das Dichten einfach nicht verbieten! Diesmal hat er “Duftmarken” gesetzt. Sein Göttinger Verleger, Gerhard Steidl, kam nämlich auf die Idee, ein Parfüm herstellen zu lassen, das nach nichts anderem als nach Büchern und Papier duftet.
Für den 61-Jährigen ist das Büchermachen ein sinnliches Erlebnis. „Der Geruch eines frischen Buchs ist betörend wie ein Rauschmittel“, sagt Steidl. „Ja, dieser Duft ist dein Parfüm“, bemerkt der US-Fotograf Robert Frank in einem Dokumentarfilm über Steidl, als ihn der Verleger an einem neuen Bildband schnuppern lässt. Wegen dieser Szene regte das britische Lifestyle-Magazin „Wallpaper“ das gemeinsame Projekt an.
 Und weil in der Göttinger Provinz nicht viel los ist (der Verfasser dieser Zeilen spricht aus Erfahrung), wurde fürs Produktdesign kein geringerer als Karl Lagerfeld angeworben und fürs Werbetextchen auf der Packung war Günter Grass zuständig. Er steht damit in durchaus ehrenwerter Tradition: der Dichter Frank Wedekind stand einst als Werbechef bei Julius Maggi unter Vertrag. Kostprobe:
Und weil in der Göttinger Provinz nicht viel los ist (der Verfasser dieser Zeilen spricht aus Erfahrung), wurde fürs Produktdesign kein geringerer als Karl Lagerfeld angeworben und fürs Werbetextchen auf der Packung war Günter Grass zuständig. Er steht damit in durchaus ehrenwerter Tradition: der Dichter Frank Wedekind stand einst als Werbechef bei Julius Maggi unter Vertrag. Kostprobe:
»Vater, mein Vater! Ich werd nicht Soldat! Dieweil man bei der Infanterie nicht Maggi-Suppe hat!« – »Söhnchen, mein Söhnchen! Kommst Du erst zu den Truppen, So isst man dort auch längst nur Maggis Fleischkonservensuppen.«
Das Duftdesign besorgte der Berliner Parfümeur Geza Schön. Nun hat der Duft der Bücher wirklich etwas. Der Verfasser dieser Zeilen gibt zu, selbst Schnüffler zu sein und seine Buchschätze durchaus auch zu beschnuppern. Doch wenn wir ehrlich sind: Das Wort, das dieses Geruchserlebnis am besten beschreibt, ist am ehesten “muffig”. Der Göttinger Verleger veranlasste darum auch den Duftkreateur, noch Moschus und Osmanthus unters Odeur zu mixen zwecks des Wohlgeruchs. Ach, ginge das doch auch bei Lyrik!