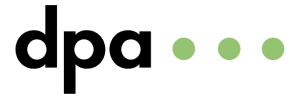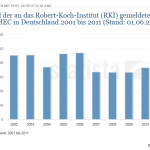“Die Hölle, das sind die anderen”, hat Sartre einst in seinem Theaterstück “Geschlossene Gesellschaft” geschrieben. Die Hölle für (freie) Journalisten, das können Redaktionen sein, die durch unmögliche Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung oder krasse Verstöße gegen das Urheberrecht auffallen. Die “Freischreiber”, ein Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten, hat nun den “Himmel und Hölle”-Preis ausgelobt. Ausgezeichnet sollen solche Redaktionen werden, die sich an den von den “Freischreibern” selbst konzipierten “Code of Fairness” halten (“Himmel”) oder eben in besonders krasser Form dagegen verstoßen (“Hölle”):
Es gibt Gründe, warum Redaktionen freien Journalisten wie der Himmel vorkommen – und ebenso Gründe, warum andere nicht. Wie sich der Berufsverband Freischreiber eine gute Zusammenarbeit vorstellt, hat er kürzlich im Code of Fairness beschrieben.
Der Himmel für Freie Journalisten ist nach Meinung der “Freischreiber” (die Nominierten werden in einem Online-Voting ermittelt) in den Redaktionen von P.M. Magazin, Brand eins und Enorm verwirklicht. Die Journalistenhölle dagegen sollen die Redaktionen von Für Sie, Neon und Spiegel Online sein. Anders als im “Himmel” gibt es für die “Hölle”-Kandidaten keine Begründung, dafür aber eine metaphorische Geschichte, die den Alltag von Journalisten in betreffenden Redaktionen darstellen soll:
Ich hatte einen Traum. Ich war in der Hölle. Das Neonlicht flackerte. Eine Horde Redakteure kam auf mich zugerannt. „Gib uns deine Themen“, riefen sie. Ihre Gesichter kamen mir bekannt vor. Sie entrissen mir meine Papiere und brachten sie dem Chefredakteur, der mit einem Dreizack an einer langen Tafel thronte. Er liess sich meine Themen vorlesen und schrie seinen Redakteuren zu: Diese Geschichte machst Du. Diese Du. Für mich war keins meiner Themen übriggeblieben.
Ich rannte in den nächsten Raum. Der Raum war fast leer. Nur an den Wänden Regale, auf denen Diät Bücher standen. An den Wänden hingen Bilder der Jahreszeiten. Auf dem Bildschirm sah ich einen Text. Darüber mein Name. Das Thema kam mir bekannt vor. Der Text nicht. War wirklich Claudia Schiffer die neue Königin von Sansibar? »Hier werde ich bis zu meinem Lebensende wohnen«, sagte sie. Ich hatte nie mit ihr gesprochen.
Entsetzt wandte ich mich ab. Im nächsten Raum ging es hektisch zu. Redakteure saßen an ihren Rechnern und spitzten Themen zu. Niemand beachtete mich. Ich rief: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die fieseste im ganzen Land?« An den Wänden hingen die armen Seelen von Online-Kollegen und bettelten um Honorare. Ich wachte auf.
Neon-Chefredakteur Michael Ebert hat mittlerweile auf die Nominierung reagiert und sie beim Branchendienst Meedia als “unseriös und bald Rufmord” bezeichnet.